Mit ihrem zweiten Album World Panopticon erweitert das finnische Industrial-Metal-Projekt DOME RUNNER seine klangliche und konzeptionelle Identität weit über die geradlinige Aggression des Debüts hinaus. Die Platte ist ein 77-minütiger Abstieg in dystopische Überwachungsstrukturen, der zwischen hartem Industrial Metal, hämmernden rhythmischen Konstruktionen und unerwartet atmosphärischen elektronischen Passagen wechselt. Es ist ein Werk, das gleichermaßen von Science-Fiction, gesellschaftlicher Beobachtung und einem präzisen Verständnis dafür geprägt ist, wie Maschinenhaftigkeit, Wiederholung und Spannung zu narrativer Form werden können. Wir sprachen mit DOME RUNNER, genauer gesagt mit Simo Perkiömäki (Songwriting, Gesang, Gitarre, Programmierung), über die Ideen, Prozesse und Einflüsse hinter World Panopticon – und darüber, wie ihre Zukunftsvision die Welt widerspiegelt, in der wir heute leben.
Viele behaupten, Industrial Metal sei tot – euer Album beweist das Gegenteil. Wie siehst du den aktuellen Zustand von Industrial Metal, und wo positioniert ihr euch darin?
Simo: Naja, ich weiß nicht, ob er so tot ist, wie er einfach beschissen ist. Statt reiner, seelenerschütternder Brutalität ist zumindest finnischer Industrial Metal schon lange nichts als Bullshit-Disco für Metalheads, und wir haben kein Problem damit, ein wohlverdienter giftiger Stich gegen diese misogynistische Ooga-Booga-Bullshit-Sphäre zu sein. Insgesamt gibt es aber ein paar Bands, die etwas Bemerkenswertes für das Genre als Ganzes getan haben, wie Code Orange, vor allem mit „Forever“, und auch die letzten beiden Alben von Candy, aber das ist auch schon alles, was auf meinem Radar ist. Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass wir einfach eine Band unter vielen innerhalb eines bestimmten Stils sind. Und das ist gut so.
Finnland hat derzeit eine sehr starke Extreme-Metal-Szene mit vielen bemerkenswerten Bands. Fühlst du dich als Teil dieser Gemeinschaft, oder bevorzugst du es, dass Dome Runner eher isoliert von Trends und Szenen bleibt?
Wir sind von Natur aus von Trends isoliert, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir zu einer Art Underground-Gemeinschaft von Bands gehören, einfach weil wir viele Bands spielen, Shows buchen und aktiv bleiben. Auch wenn wir mit vielen Freunden aus ganz unterschiedlichen Bands Konzerte gespielt haben, habe ich das Gefühl, dass wir der finnischen Hardcore-Szene in gewisser Weise verdanken, wer wir sind – sie hat uns die Möglichkeit gegeben, Shows zu spielen und Dinge konkret zu formen, zu einer Zeit, als es sonst niemand getan hätte, und hat uns von Tag eins an unterstützt. Dafür gebührt Respekt.
 „World Panopticon“ ist ein Konzeptalbum. Wie wichtig ist das Konzeptformat für den Ausdruck eurer Musik?
„World Panopticon“ ist ein Konzeptalbum. Wie wichtig ist das Konzeptformat für den Ausdruck eurer Musik?
Nicht sehr wichtig und sehr wichtig zugleich. Der Punkt ist, dass unser kreativer Prozess nicht besonders selbstbewusst oder geplant ist, bis wir irgendwann feststellen, dass wir eine Reihe von Songs haben, die – richtig sequenziert – eine klare rote Linie ergeben. Wir haben keinen 77-minütigen Koloss geschrieben, sondern lediglich erkannt, dass er sich selbst erschaffen hatte. Und es gibt keine verdammte Möglichkeit, dass wir auf die Bremse treten wegen irgendeiner Bullshit-Ausrede, wenn sich Dinge auf natürliche Weise weiter vorantreiben.
Was ist die thematische Verbindung zwischen dem „beobachtenden Selbst“ und eurer Idee des Panoptikons?
Die Texte sind bloße Beobachtungen von Situationen und Erfahrungen in unserer heutigen Welt, aus der Perspektive eines Individuums und zugleich aus der Perspektive eines Individuums von außen, das auf diese Welt blickt, während es gleichzeitig mit der eigenen Existenz unter dem Gewicht dieser Welt ringt. Die Verbindung und die letztliche Aussage ist, dass das Panoptikon im Beobachter selbst liegt, aber das, was dieses Panoptikon formt, eine Kombination aus Beobachtungen und Realitäten ist, die wir jeden Tag teilen und erleben – während man letztlich einen freien Geist annimmt, der Autorität und sich selbst hinterfragt und offen für Fortschritt bleibt sowie ohne Angst bereit ist, sich neu zu definieren.
Wenn du über den „beobachtenden Beobachter“ schreibst, ist das eher eine Metapher, ein psychologisches Konzept oder eine wörtlichere Vorstellung von Identität? Und was bedeutet „Rebirth“ auf eurem Album – ist es eine echte Erlösung, ein technischer Neustart oder etwas völlig anderes?
Gute Frage. Ich schreibe Texte eher, um Bilder zu erzeugen, statt mein persönliches Leben und mich selbst direkt auszudrücken, auch wenn das natürlich trotzdem darin enthalten ist. Insofern ist es eine eher wörtliche Vorstellung von Identität, aber nicht ganz. Die Idee der Wiedergeburt bedeutet keine echte Erlösung, vielleicht in gewisser Weise einen technischen Neustart, aber vielmehr den Prozess, Strukturen von Geist und Selbst – und damit die Menschheit als Ganzes und die Gesellschaft – zu hinterfragen. Nicht, um das Selbst zu zerstören, sondern um es neu zu definieren und weiterzuentwickeln.
In eurem Promotionmaterial beschreibt ihr das Album als „eine Mischung aus Beobachtung, sozialer Analyse und persönlicher Erneuerung“. Wie viel davon funktioniert als dystopische Warnung, und wie viel spiegelt unsere reale Welt wider?
Auch wenn meine Texte nicht zwingend direkt sind, spiegelt letztlich alles die reale Welt wider. Die Welt in ihrem aktuellen Zustand ist sehr dystopisch, und der digitale Albtraum, der vor Jahrzehnten imaginiert wurde, ist durch ein langsames Gären Realität geworden. Auch wenn Fiktion inspiriert, braucht man keinen Universitätsabschluss, um zu analysieren, was um einen herum passiert – ständig, überall. Man muss nur ein wenig hinschauen. Es ist nicht alles dunkel, aber definitiv auch nicht alles hell.
Eure Musik trägt klar eine Botschaft. Welche Stimmungen, emotionalen Zustände oder Reaktionen möchtet ihr beim Hörer auslösen?
Was auch immer sie in dir auslöst. Diese Songs kommen aus einem Ort, der manchmal dunkel, manchmal hell ist, aber fast ohne Ausnahme kathartisch und immer pur. Ich habe dabei nichts und alles zu verlieren. Also kann es genauso gut laut erklingen.
 Science-Fiction spielt offensichtlich eine große Rolle als nicht-musikalischer Einfluss. Woher kommt diese Inspiration, und welche weiteren nicht-musikalischen Einflüsse prägen Dome Runner?
Science-Fiction spielt offensichtlich eine große Rolle als nicht-musikalischer Einfluss. Woher kommt diese Inspiration, und welche weiteren nicht-musikalischen Einflüsse prägen Dome Runner?
Die Welt um uns herum und die Menschen in ihr sind definitiv ein nicht-musikalischer und nie endender Einfluss auf unsere Musik, hahaha. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich damit aufgewachsen, alles zu hinterfragen und mir selbst Antworten zu suchen, und Science-Fiction verkörpert genau diese Idee. Zu hinterfragen und offen sowie neugierig zu bleiben.
Was sind eure wichtigsten musikalischen Einflüsse?
ZZ Top, Kickback und Throbbing Gristle.
Euer Sound verbindet Extreme Metal, Hardcore, industrielle Maschinenstrukturen und elektronische Elemente. Wie entscheidet ihr, wann ein Song mehr „metallische Gewalt“ braucht und wann eine mechanischere, industrielle Struktur?
Gar nicht. Die Songs entstehen einfach. Es gibt immer Rhythmus und eine Synchronität zwischen Fleisch und Maschine, aber wie genau – dafür gibt es keine Regeln oder Gewissheiten.
Welche Rolle spielen industrielle Klanglandschaften, Geräusche und texturale Elemente bei der Formung eurer dystopischen Klangidentität?
Offensichtlich eine große. Wenn wir Programmierung und Sampling wegnehmen, haben wir eine Band, die Death Metal, Noise Rock, Metallic Hardcore, Thrash Metal, Alternative Rock, Killing Joke der 2000er … spielt. Die Synchronität zwischen uns und der Maschine ermöglicht es uns, alles zu tun und alles zu sein, was wir wollen.
„World Panopticon“ ist ein Doppelalbum mit einer Laufzeit von über 77 Minuten. Welche Herausforderungen gab es dabei, ein so langes, in sich geschlossenes Werk mit einem funktionierenden dynamischen Fluss zu schaffen? Und glaubst du, dass Hörer:innen heute noch die Zeit aufbringen, ein so langes Album am Stück zu hören?
Es mag manche überraschen, aber eigentlich gab es kaum welche – abgesehen von einem totalen mentalen Zusammenbruch beim Mischen. Es hat Zeit gekostet, aber ich habe es durchgezogen. Um ehrlich zu sein, haben wir irgendwann einfach festgestellt, dass wir verdammt viele Songs haben und dass sie alle funktionieren. Ich habe wirklich versucht herauszufinden, was man aus dem Ding streichen könnte, und ich konnte keinen einzigen Song fallen lassen. So ist das manchmal. Solche Platten macht heute niemand mehr, aber das ist deren verdammtes Problem. Ein gutes, in sich geschlossenes langes Album ist für mich Musik in ihrer besten Form – wenn deine Aufmerksamkeitsspanne von zehn Sekunden das nicht aushält, dann ist es eben nicht für dich gedacht. Diejenigen, die es können, finden vielleicht etwas, zu dem sie Jahre später zurückkehren. Oder vielleicht auch nicht. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber ich lege mir bis heute Platten wie „October Rust“ von Type O Negative oder „The Downward Spiral“ von Nine Inch Nails auf, und kein einziges Mal stolpere ich darüber, wie lang sie sind. Der Schlüssel ist für mich, sich darauf zu konzentrieren, großartige Songs zu schreiben, die aus einem reinen Impuls heraus entstehen, statt sich darauf zu fixieren, ein 77-minütiges Doppelalbum zu machen.
 Wie unterschied sich der Songwriting-Prozess für „World Panopticon“ vom Schreiben eures Debüts?
Wie unterschied sich der Songwriting-Prozess für „World Panopticon“ vom Schreiben eures Debüts?
Nicht besonders stark. Die Ideen sind stellenweise etwas wilder geworden, aber wir haben uns schon immer darauf konzentriert, gute Songs zu schreiben, und das war’s. Ich denke, wir hatten diesmal ein etwas breiteres Spektrum an Einflüssen, aber ja.
Ihr habt euch für einen stärker Trip-Hop-inspirierten, elektronisch geprägten Mittelteil entschieden – weniger Metal, mehr Atmosphäre. War das eine bewusste narrative Entscheidung oder haben sich die Songs einfach in diese Richtung entwickelt?
Ich habe das spontan beim Mischen des Albums entschieden, also ja, in gewisser Weise war es eine bewusste narrative Entscheidung.
Euer Sound hat sich deutlich weiterentwickelt. In Bezug auf Produktion, Gitarrensounds, Rhythmen, Gesang und Gesamtkomposition – was waren die größten technischen oder kreativen Durchbrüche bei „World Panopticon“?
Ich denke, dass eine gewisse Definition und ein über die Zeit entwickelter Charakter dazu geführt haben, dass wir ziemlich genau wussten, wie die Dinge „klingen sollen“. Außerdem haben wir aufgehört, die Vocals ständig in Effekten zu ertränken, und sind je nach Song, Part usw. breiter an die Sache herangegangen. Ich glaube, die Songs wirken natürlicher, und unsere Arroganz, sich einen Dreck darum zu scheren, was richtig oder falsch ist, solange es gut ist, scheint deutlich durch. Ich werde immer dafür verdammt sein, unsere eigenen Platten zu mischen, aber die Wahrheit ist, dass die Detailversessenheit und der Grad an Kontrolle jemand anderen in den Wahnsinn treiben würden – also ist es etwas, das man selbst machen muss, wenn man ohnehin schon mittendrin ist, haha.
Aufnahmen können inspirierend, aber auch schwierig sein. Wie war die Erfahrung diesmal? Gab es besondere Schwierigkeiten oder Unterschiede im Vergleich zu früheren Sessions? Das Album hat Momente mit roher, fast abrasiver Produktion und andere, die klarer und ausgefeilter klingen. War das ein bewusst gesetzter künstlerischer Kontrast oder das Ergebnis von Aufnahmeproblemen?
Die Aufnahmen waren tatsächlich sehr einfach. Die Instrumente haben ein paar Tage gebraucht, Vocals und Programmierung wie immer den Großteil der Zeit. Es gab aber keine wirklichen Schwierigkeiten. Ich habe im Prozess genug Abstand genommen, um mich darauf zu konzentrieren, wo und wie man Dinge verbessern kann. Die Vielfalt in der Produktion ist immer ein bewusst gesetzter künstlerischer Kontrast. Wir machen unsere Hausaufgaben, bevor wir im Studio die Richtung festlegen, aber manche Dinge sollen genau so brutal und abrasiv sein, wie sie sind.
Euer Album ist erst seit ein paar Wochen draußen. Wie läuft es bisher, und wie fühlst du dich persönlich jetzt damit, wo es draußen in der Welt ist?
Es fühlt sich gut an, dass die Platte draußen ist. Sie hat alles gefordert, was wir hatten, und die Tafel für neue Musik komplett leergewischt. Ich denke, so ein Album braucht etwas Zeit, um anzukommen, aber ich bin zuversichtlich. Es wäre nicht veröffentlicht worden, wenn es komplett scheiße wäre.
Wenn eure Musik oft mit Maschinen oder fabrikartigen dystopischen Bildern verbunden wird: Wie wichtig ist der visuelle Aspekt – Artwork, Videos, Ästhetik, Live-Visuals – für Dome Runner? Und wie nutzt ihr Live-Auftritte, um die visuelle und konzeptionelle Welt hinter eurer Musik zu verstärken?
Sehr wichtig. Deshalb machen wir das meiste selbst. Wir haben einfach zu viel eigene Vision für alles, haha. Wann immer es zur Gelegenheit passt, haben wir bei unseren Live-Shows Visuals eingesetzt, aber nicht immer. Das hängt stark von den Umständen ab.
Plant ihr, visuelle „Panoptika“, Machine-Art-Elemente oder andere konzeptionelle Installationen künftig stärker in eure Live-Shows zu integrieren? Gibt es in naher Zukunft Konzerte? Kommt ihr nach Wien oder irgendwo nach Österreich?
Vielleicht. Wir werden sehen. Sehr wahrscheinlich zumindest bei manchen Gelegenheiten. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr zu touren und generell so viel wie möglich zu spielen. Wir hoffen, auch in Wien und/oder Österreich spielen zu können.
 Gehen wir zurück zum Anfang: Wie begann deine persönliche Reise im Metal? Was hat dich speziell zu extremem Metal gezogen? Welche Bands oder Künstler haben dich am stärksten geprägt?
Gehen wir zurück zum Anfang: Wie begann deine persönliche Reise im Metal? Was hat dich speziell zu extremem Metal gezogen? Welche Bands oder Künstler haben dich am stärksten geprägt?
Nun ja, mein Vater hat es irgendwie verbockt und mir Metallica vorgespielt, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, und seitdem war nichts mehr wie zuvor, haha! Kurz danach habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, und der Rest ist Geschichte. Ich erinnere mich, dass ich mit etwa acht Jahren heimlich nach dem Zubettgehen Headbangers Ball Mitte der 2000er geschaut habe und dort viele Bands entdeckt habe, die mich fürs Leben geprägt haben. Ich denke, YouTube war revolutionär für neue Musik, aber nachdem ich durch Punkrock meine bis heute besten Freunde kennengelernt habe, habe ich auch gleichgesinnte Menschen mit ähnlichen Interessen an Musik und verschiedenen Stilen gefunden. Künstler, die mich am meisten geprägt haben, sind wohl Killing Joke, Metallica, Anthrax, Sepultura, Integrity, Kaaos, Godflesh, Strapping Young Lad, Nine Inch Nails, Fear Factory, Pitchshifter, Beherit, Faith No More und Type O Negative – um nur einige zu nennen, aber es gibt viele mehr.
Euer Bandname ist sehr ungewöhnlich. Was bedeutet „Dome Runner“ für dich, und wie seid ihr darauf gekommen? Gibt es eine konkrete Geschichte hinter dem Namen?
Ein bisschen simpel vielleicht, aber letztlich stand während der Demoaufnahmen 2019 entweder Domecrusher oder Dome Runner zur Auswahl, und wir haben uns für Letzteres entschieden. Zur Erklärung: Ich hatte bereits 2014 einige Songs geschrieben, darunter „In Pain“ vom ersten Album, damals unter dem Namen Domecrusher, habe das Projekt aber wegen mangelndem Selbstvertrauen und Mut, mich auszudrücken, auf Eis gelegt – so wie viele andere gemobbte und kaputtgemachte Kids. Später wurde mir klar, dass der Name letztlich den Beobachter von außen repräsentiert. Außerdem ist Dome Runner eine Figur aus Warhammer, die Necromundan-Underhive-Vagabunden bezeichnet, die als lokale Guides für Gangs fungieren, wenn diese ihr Territorium in bislang unbekannte Gebiete ausdehnen. Auch wenn wir keinen Warhammer Metal spielen, hatte diese Definition eine ähnliche Note wie das, was ich mir vorgestellt habe – und das hat den Namen zusätzlich bestärkt.
Zum Abschluss dieses Interviews: Die letzten Worte gehören dir. Gibt es noch etwas, das du hinzufügen möchtest – eine Botschaft an eure Hörer:innen, einen Gedanken zum Album oder etwas, das du teilen willst?
Hab keine Angst davor, der zu sein, der du bist. Angst ist der Gedankenkiller. Bleib offen und fokussiert.
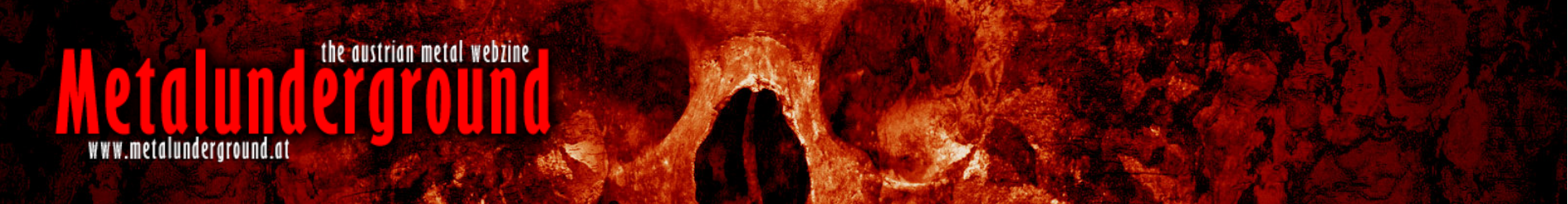



















 Haunt 🇺🇸 – Ignite (Heavy Metal)
Haunt 🇺🇸 – Ignite (Heavy Metal)

 HALESTORM 🇺🇸 – Everest (Alternative Metal/Hard Rock)
HALESTORM 🇺🇸 – Everest (Alternative Metal/Hard Rock)

 Metal Faust 🇩🇪 – Demo 2025 (Heavy Metal)
Metal Faust 🇩🇪 – Demo 2025 (Heavy Metal)



 Castle Rat 🇺🇸 – The Bestiary (Epic/Doom/Stoner Metal)
Castle Rat 🇺🇸 – The Bestiary (Epic/Doom/Stoner Metal)
 Maahes 🇩🇪 – Nechacha (Melodic Black Metal)
Maahes 🇩🇪 – Nechacha (Melodic Black Metal) IGORRR 🇫🇷 – Amen (Experimental Extreme Metal)
IGORRR 🇫🇷 – Amen (Experimental Extreme Metal) Christone „Kingfish“ Ingram 🇺🇸 – Hard Road (Blues Rock)
Christone „Kingfish“ Ingram 🇺🇸 – Hard Road (Blues Rock)


































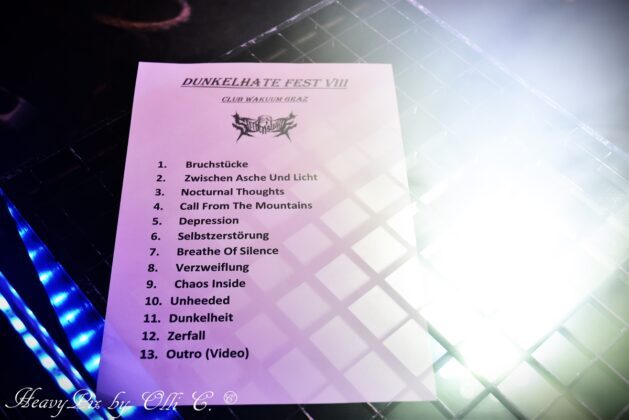




 „World Panopticon“ ist ein Konzeptalbum. Wie wichtig ist das Konzeptformat für den Ausdruck eurer Musik?
„World Panopticon“ ist ein Konzeptalbum. Wie wichtig ist das Konzeptformat für den Ausdruck eurer Musik? Science-Fiction spielt offensichtlich eine große Rolle als nicht-musikalischer Einfluss. Woher kommt diese Inspiration, und welche weiteren nicht-musikalischen Einflüsse prägen Dome Runner?
Science-Fiction spielt offensichtlich eine große Rolle als nicht-musikalischer Einfluss. Woher kommt diese Inspiration, und welche weiteren nicht-musikalischen Einflüsse prägen Dome Runner? Wie unterschied sich der Songwriting-Prozess für „World Panopticon“ vom Schreiben eures Debüts?
Wie unterschied sich der Songwriting-Prozess für „World Panopticon“ vom Schreiben eures Debüts? Gehen wir zurück zum Anfang: Wie begann deine persönliche Reise im Metal? Was hat dich speziell zu extremem Metal gezogen? Welche Bands oder Künstler haben dich am stärksten geprägt?
Gehen wir zurück zum Anfang: Wie begann deine persönliche Reise im Metal? Was hat dich speziell zu extremem Metal gezogen? Welche Bands oder Künstler haben dich am stärksten geprägt?