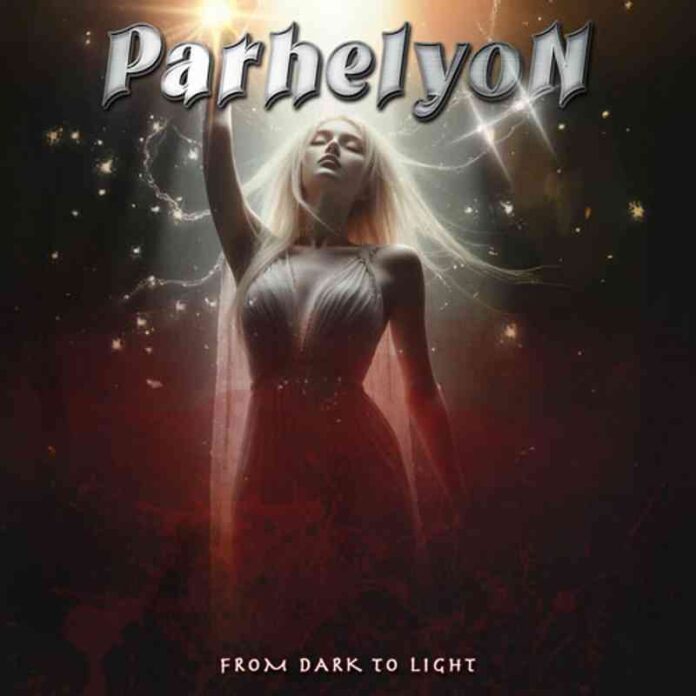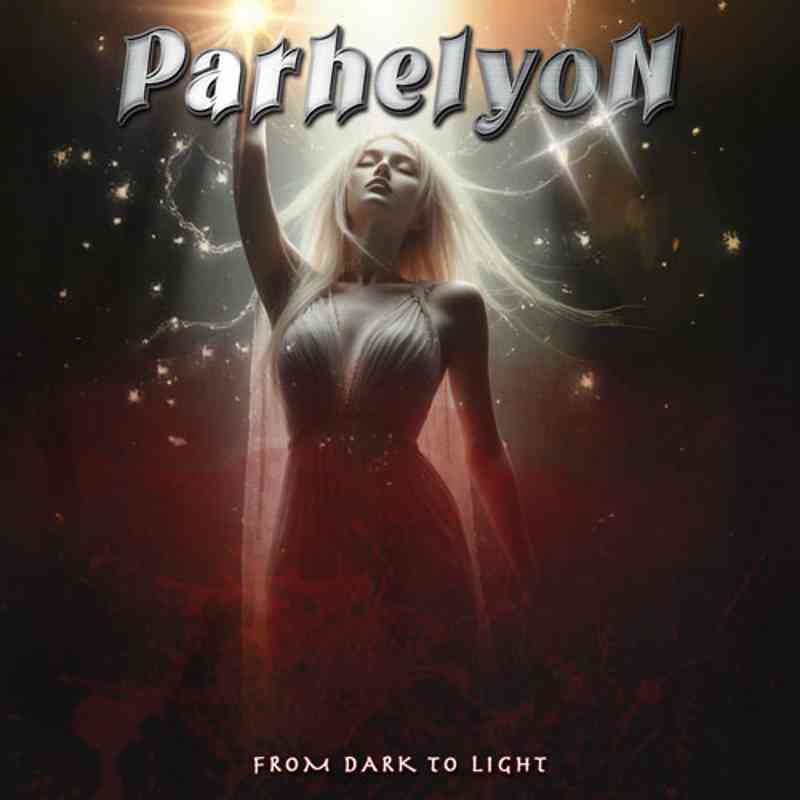Kalifornien, 2022, eine junge Band gab nach drei Jahren des Bestehens ihr Debüt mittels einer selbstbetitelten EP und verzaubert nicht nur eingeschworene Gatekeeper, sondern auch die Mainstreamfachpresse. Und dies vollkommen zurecht.
Ein paar Monate später folgte mit Gates Of Twilight ein vorbildliches Debüt, welches neben den großartigen Gitarren und professionellerem Songwriting auch einen in Nuancen verbesserten, ohnehin sensationellen Gesang präsentierte.
Und für wahr, die Stimme von Leo Unnermark hat eine frappierende Ähnlichkeit mit dem jungen Geoff Tate. Allerdings auch (haßt mich ruhig dafür) extreme Joacim Cans – Vibes.
Wer damals etwas verpaßt hatte, dem sei gesagt, daß es hier um WINGS OF STEEL geht.
Da die Band mit WINDS OF TIME nun just ihren zweiten Rundling auf den Markt geworfen hat, wird es Zeit , das aktuelle Werk einer der besten jungen Heavy Metal Bands heutzutage einmal genauer zu betrachten.
Im Gegensatz zu den meisten anderen US – Newcomern macht die Band einiges anders.
So hört man, wie in Saints And Sinners oder Flight Of The Eagle durchaus europäische Einflüsse wie Judas Priest, Iron Maiden und Saxon heraus, das Hauptaugenmerk der Amis liegt jedoch auf den heimatlichen Bands wie beispielsweise alten Queensryche und Crimson Glory.
Doch statt sich irgendwelcher Vorbilder voll hinzugeben, bindet man lediglich prägnante Elemente der Lieblingsbands mit in die Liedgestaltung ein. Der Opener und Titeltrack ist hierbei ein schönes Beispiel.
Wobei man sich schon fragen kann, ob es Mut oder Größenwahn ist, einen fast elfminütigen Song von dieser Qualität an den Beginn eines Albums zu setzen.
Denn WINDS OF TIME hat ein großes „Problem“!
Und das ist eben erwähnter Song. Beginnend mit Judas Priest – artigem Riffing schwingt er gelegentlich auf Riot V um, macht dort im Refrain kurz rast, dann ballert man bei der Abfahrt als Bridge offensichtlich einen aus der Metal Church – Kanone, aber mit Megadeath – Munition, täuscht im Mittelteil Slayer an, biegt dann aber Richtung ganz früher Queensryche ab, nur um dann mittels nicht nur einem unglaublichen Gitarrensolo in die Zielgerade zu kommen.
Und hinter der steht, so größenwahnsinnig bin jetzt mal, steht der Metalolymp.
Denn Winds Of Time ist nicht nur einer der besten Genrebeiträge aller Zeiten, er erspart mir in Zukunft auch wenigstens zwanzig Minuten meiner Lebenszeit, wenn mich mal wieder jemand fragt, was diesen US Metal ausmacht.
Ganz klar ist es die perfekte Mischung aus Aggression und Melodie, welches man bislang anhand von ungefähr zehn Bands ohne viel Geschwafeln vorspielen konnte, von nun an reicht ein Song. Danke dafür!
Nach diesem Traumstart kann man das Niveau jedoch nicht halten.
Jedenfalls nicht ganz. Infolge kann man dieses überirdische Niveau nur nochmals annähernd mit dem zwischen Einflüssen aus Crimson Glory, Judas Priest und ganz alten Helloween geschmiedeten To Die In Holy War erreichen. Allerdings macht man nichts verkehrt, sondern im Gegenteil, trotzdem alles richtig.
Saints And Sinners ist nach der überlangen Odyssee eingangs ein geschickt platziertes Pendant zum Meisterwerk, während das balladeske Crying nicht nur eine Verschnaufspause bietet.
Es läßt Erinnerungen an die Glanztaten einiger US Metal Bands wach werden.
Weiterere Höhepunkte sind das zu Beginn seichte We Rise, welches neben Fifth Angel auch von Dokken beeinflußt zu seien scheint und der mit mittelschweren Fates Warning – Referenzen aufwartende, im Stile eines siebziger Jahre Judas Priest – Epos geschriebene Abschluß.
Hier gibt es nur ein Fazit!
Insgesamt sehe ich hier nicht nur eines der besten Alben im Heavy Metal in diesem Jahr.
WINDS OF TIME hat das Zeug dazu, ein Klassiker zu werden. Und nein, nicht nur im US Metal Bereich, ich meine im traditionellen Heavy Metal.
Das wäre übrigens für einige Ewiggestrige, welche ihren alten Helden nachtrauern und täglich rumjanken, daß angeblich nichts nachkäme, sowohl der richtige Zeitpunkt als auch die richtige Band, entweder in die Zukunft zu schauen oder allein im Keller zu heulen!
Denn (nicht nur) in dieser geerdeten Band steckt unglaubliches musikalisches und kommerzielles Potenzial. WINGS OF STEEL, vorausgesetzt die Band bleibt weiterhin dran und hält das Niveau, gehört nicht nur die Zukunft. Die sind es!
Nachtrag: Das Label legt übrigens alle Veröffentlichungen der Band neu auf. Insofern lohnt sich nach dem Check dieser Platte eine Sammelbestellung.
Tracklist
01. Winds Of Time
02. Saints And Sinners
03. Crying
04. Burning Sands
05. To Die In Holy War
06. Lights Go Out
07. We Rise
08. Flight Of The Eagle
Besetzung
Leo Unnermark – Gesang
Parker Halub – Gitarren, Baß
Damien Rainaud – Schlagzeug
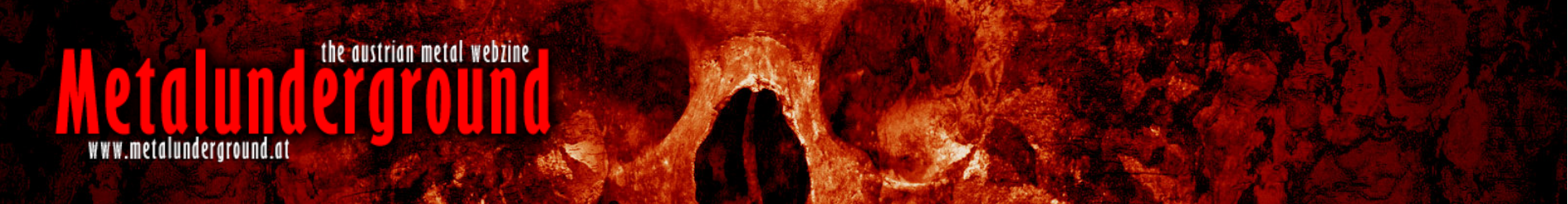









 C.S. (Cyntia Paré) am Bass – bekannt von der kanadischen Band Gevurah – hielt sich szenisch dezent im Hintergrund, doch ihr Bassspiel verlieh dem Sound Kraft und Tiefe. Komplettiert wurde das Trio durch L.S. (Lukas Lichtenfels) an den Drums, erfahren durch frühere Bands wie Bifröst oder Selbstentleibung sowie als Live-Mitglied bei Anomalie, Nebelfront und Tulsadoom. Entsprechend präzise und druckvoll war sein Spiel.
C.S. (Cyntia Paré) am Bass – bekannt von der kanadischen Band Gevurah – hielt sich szenisch dezent im Hintergrund, doch ihr Bassspiel verlieh dem Sound Kraft und Tiefe. Komplettiert wurde das Trio durch L.S. (Lukas Lichtenfels) an den Drums, erfahren durch frühere Bands wie Bifröst oder Selbstentleibung sowie als Live-Mitglied bei Anomalie, Nebelfront und Tulsadoom. Entsprechend präzise und druckvoll war sein Spiel. Als es endlich losging, überraschte die Band mit hohem Tempo und druckvollem Sound – live deutlich stärker als auf ihrem Debütalbum, das ebenfalls dieses Jahr erschienen ist. Die Setlist basierte fast vollständig auf diesem Release.
Als es endlich losging, überraschte die Band mit hohem Tempo und druckvollem Sound – live deutlich stärker als auf ihrem Debütalbum, das ebenfalls dieses Jahr erschienen ist. Die Setlist basierte fast vollständig auf diesem Release. Gegründet in Chile und mittlerweile in Niederösterreich beheimatet, ist TRIUMPHAL VENGEANCE das Projekt von Nebel – alias Son of Mourning (bürgerlich Marcelo Ríos Hiems), einem bekannten Namen der chilenischen Szene, unter anderem bei Funestus aktiv. Seine verzweifelten Schreie und klagenden Gesänge prägten den Sound. Doch nachdem er zuvor unermüdlich nach mehr Hall verlangt hatte, klangen die Vocals nun übertrieben verhallt, stellenweise kaum verständlich und wenig überzeugend.
Gegründet in Chile und mittlerweile in Niederösterreich beheimatet, ist TRIUMPHAL VENGEANCE das Projekt von Nebel – alias Son of Mourning (bürgerlich Marcelo Ríos Hiems), einem bekannten Namen der chilenischen Szene, unter anderem bei Funestus aktiv. Seine verzweifelten Schreie und klagenden Gesänge prägten den Sound. Doch nachdem er zuvor unermüdlich nach mehr Hall verlangt hatte, klangen die Vocals nun übertrieben verhallt, stellenweise kaum verständlich und wenig überzeugend.
 Gegründet wurde die Band 2009 von Naas Alcameth (Kyle Earl Spanswick), bekannt durch Projekte wie Nightbringer, Bestia Arcana oder Excommunion. Live übernahm er Rhythmusgitarre und Gesang, während die atmosphärischen Elemente in der Studioversion ebenfalls aus seiner Feder stammen. Unterstützt wurde er von Eoghan an den Drums, Nox Corvus an der Leadgitarre und Abraxas Nox am Bass.
Gegründet wurde die Band 2009 von Naas Alcameth (Kyle Earl Spanswick), bekannt durch Projekte wie Nightbringer, Bestia Arcana oder Excommunion. Live übernahm er Rhythmusgitarre und Gesang, während die atmosphärischen Elemente in der Studioversion ebenfalls aus seiner Feder stammen. Unterstützt wurde er von Eoghan an den Drums, Nox Corvus an der Leadgitarre und Abraxas Nox am Bass. Die Setlist war sorgfältig aufgebaut, in umgekehrter Chronologie: von neueren Songs wie „Maze of Phobetor“, „Pnigalion“ und „Ephialtes“ bis zu Klassikern wie „The Dreaming Eye“ und „Tides of Oneiric Darkness“ vom Debütalbum. Jeder Song steigerte die Dichte und Dunkelheit des Moments.
Die Setlist war sorgfältig aufgebaut, in umgekehrter Chronologie: von neueren Songs wie „Maze of Phobetor“, „Pnigalion“ und „Ephialtes“ bis zu Klassikern wie „The Dreaming Eye“ und „Tides of Oneiric Darkness“ vom Debütalbum. Jeder Song steigerte die Dichte und Dunkelheit des Moments.





 Ursprünglich waren Goatwhore als Opener angekündigt, doch da Sammy Duet derzeit mit dem Acid Bath-Reunion-Projekt beschäftigt ist, sprangen NERVOSA ein – und machten ihre Sache hervorragend. Klar, Goatwhore sind live großartig, aber NERVOSA überzeugten mit Spielfreude und Präsenz. Songs wie „Jailbreak“ oder der Schlusstrack „Endless Ambition“ sorgten für beste Stimmung. Der Sound war solide, wenn auch nicht überragend – für eine Vorband aber völlig in Ordnung. Einziger Minuspunkt: Das Set war mit rund 25 Minuten viel zu kurz. Kaum ist man richtig drin, ist es schon vorbei. Aber die Band versprach eine baldige Rückkehr – darauf darf man sich freuen.
Ursprünglich waren Goatwhore als Opener angekündigt, doch da Sammy Duet derzeit mit dem Acid Bath-Reunion-Projekt beschäftigt ist, sprangen NERVOSA ein – und machten ihre Sache hervorragend. Klar, Goatwhore sind live großartig, aber NERVOSA überzeugten mit Spielfreude und Präsenz. Songs wie „Jailbreak“ oder der Schlusstrack „Endless Ambition“ sorgten für beste Stimmung. Der Sound war solide, wenn auch nicht überragend – für eine Vorband aber völlig in Ordnung. Einziger Minuspunkt: Das Set war mit rund 25 Minuten viel zu kurz. Kaum ist man richtig drin, ist es schon vorbei. Aber die Band versprach eine baldige Rückkehr – darauf darf man sich freuen.
 Der Start war ein Schlag in die Magengrube: „Curse the Gods“ – ein Song, der auch vier Jahrzehnte später nichts an Wirkung verloren hat. Diese Riffs, Schmiers unverwechselbare Stimme – pure Energie. Mit „Nailed to the Cross“ ging’s weiter, einer Hymne der frühen Thrash-Geschichte. Das Publikum tobte, der Moshpit nahm Form an, und fast die gesamte Arena headbangte. Klassiker wie „Mad Butcher“ oder „No Kings No Masters“ trieben die Stimmung auf den Höhepunkt.
Der Start war ein Schlag in die Magengrube: „Curse the Gods“ – ein Song, der auch vier Jahrzehnte später nichts an Wirkung verloren hat. Diese Riffs, Schmiers unverwechselbare Stimme – pure Energie. Mit „Nailed to the Cross“ ging’s weiter, einer Hymne der frühen Thrash-Geschichte. Das Publikum tobte, der Moshpit nahm Form an, und fast die gesamte Arena headbangte. Klassiker wie „Mad Butcher“ oder „No Kings No Masters“ trieben die Stimmung auf den Höhepunkt. Wie seit zwei Jahrzehnten starteten sie mit „Redneck Stomp“ – ein rein instrumentaler Song, aber was für einer! Energiegeladen, dynamisch, einfach perfekt als Eröffnung. Danach „Sentence Day“, und John Tardys unverkennbare, infernalische Schreie erfüllten die Halle.
Wie seit zwei Jahrzehnten starteten sie mit „Redneck Stomp“ – ein rein instrumentaler Song, aber was für einer! Energiegeladen, dynamisch, einfach perfekt als Eröffnung. Danach „Sentence Day“, und John Tardys unverkennbare, infernalische Schreie erfüllten die Halle. Der Sound war massiv – donnernde Drums, ein wuchtiger Bass, ein bedrückend dichter Klang. Der Moshpit nahm bald ein Viertel der Arena ein, dazu Nebel ohne Ende – man konnte die Band kaum noch erkennen. Songs wie „Infected“ oder „Cause of Death“ steigerten die Energie noch weiter, Crowdsurfer flogen über die Menge. Die Stimmung war ekstatisch, der Sound hervorragend ausbalanciert.
Der Sound war massiv – donnernde Drums, ein wuchtiger Bass, ein bedrückend dichter Klang. Der Moshpit nahm bald ein Viertel der Arena ein, dazu Nebel ohne Ende – man konnte die Band kaum noch erkennen. Songs wie „Infected“ oder „Cause of Death“ steigerten die Energie noch weiter, Crowdsurfer flogen über die Menge. Die Stimmung war ekstatisch, der Sound hervorragend ausbalanciert.

 Auch „WWIII“ und „Practice What You Preach“ zündeten live sofort. Die Band präsentierte sich aktiv, ständig in Bewegung, perfekt aufeinander eingespielt. Alex Skolnick brillierte mit seinen typischen, technisch brillanten Solos, Steve DiGiorgio mit seinem dynamischen Bassspiel, alles klang glasklar und druckvoll. Die Arena hatte an diesem Abend einen exzellenten Sound.
Auch „WWIII“ und „Practice What You Preach“ zündeten live sofort. Die Band präsentierte sich aktiv, ständig in Bewegung, perfekt aufeinander eingespielt. Alex Skolnick brillierte mit seinen typischen, technisch brillanten Solos, Steve DiGiorgio mit seinem dynamischen Bassspiel, alles klang glasklar und druckvoll. Die Arena hatte an diesem Abend einen exzellenten Sound. Im Verlauf des Konzerts zog vor allem Steve DiGiorgio die Aufmerksamkeit auf sich, ständig auf den Podesten kletternd, mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz. Er war eindeutig in Bestform – sein massiver Beitrag zum Sound und seine Energie waren beeindruckend. Der Bassist stieß 1998 erstmals zu Testament, kehrte 2014 zurück und ist seither fester Bestandteil – ein Bassist von Weltklasse. Neben ihm stand Gründungsmitglied Eric Peterson an der Rhythmusgitarre, professionell, präzise, mit satten Riffs; Alex Skolnick, für die allgegenwärtigen Solos verantwortlich, bleibt eine zentrale Figur der Band – ebenso wie Chuck Billy, die Stimme, der Frontmann. Neu dabei ist Chris Dovas am Schlagzeug – und der bewies mit einem starken, energiegeladenen Drumsolo eindrucksvoll sein Können.
Im Verlauf des Konzerts zog vor allem Steve DiGiorgio die Aufmerksamkeit auf sich, ständig auf den Podesten kletternd, mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz. Er war eindeutig in Bestform – sein massiver Beitrag zum Sound und seine Energie waren beeindruckend. Der Bassist stieß 1998 erstmals zu Testament, kehrte 2014 zurück und ist seither fester Bestandteil – ein Bassist von Weltklasse. Neben ihm stand Gründungsmitglied Eric Peterson an der Rhythmusgitarre, professionell, präzise, mit satten Riffs; Alex Skolnick, für die allgegenwärtigen Solos verantwortlich, bleibt eine zentrale Figur der Band – ebenso wie Chuck Billy, die Stimme, der Frontmann. Neu dabei ist Chris Dovas am Schlagzeug – und der bewies mit einem starken, energiegeladenen Drumsolo eindrucksvoll sein Können. Nach diesem Solo kehrte auch die Energie des Anfangs zurück – mit besseren Songs und einer deutlich dynamischeren Performance. Infanticide A.I. und Shadow People, wohl die stärksten Songs des aktuellen Albums Para Bellum, funktionierten live hervorragend und trieben das Publikum ordentlich an. Mit Electric Crown und Into the Pit zum Abschluss zeigte sich eine Band in voller Explosion – mit Leidenschaft, Präzision und Kraft.
Nach diesem Solo kehrte auch die Energie des Anfangs zurück – mit besseren Songs und einer deutlich dynamischeren Performance. Infanticide A.I. und Shadow People, wohl die stärksten Songs des aktuellen Albums Para Bellum, funktionierten live hervorragend und trieben das Publikum ordentlich an. Mit Electric Crown und Into the Pit zum Abschluss zeigte sich eine Band in voller Explosion – mit Leidenschaft, Präzision und Kraft.